In meinem Blog geht es um Kulinarisches und unter dem Stichwort „Köln entdecken“ erwarten viele eher etwas zum Thema Kölsche Küche und Kölsche Tapas. Euch sei unter dem Link schon mal geholfen.

In diesem Artikel geht es mehr um die Stadt, insbesondere die Altstadt, den Dom, den Rheinauhafen und was es dort alles zu sehen gibt. Anlässlich einer kleinen Führung rund um den Kölner Dom und die Altstadt habe ich diesen Artikel „Köln entdecken“ als Anhaltspunkt und Sammlung von Ideen geschrieben, die jeder gerne für seinen kleinen privaten Rundgang rund um den Dom nutzen kann.
Alle hier beschriebenen Lokalitäten (Restaurant, Café, Brauhaus) beruhen auf privaten Erlebnissen, wobei ich nur die, die ich bzw. meine Gäste besucht haben und sind werbe- und einnahmenfrei, wobei ich die weniger guten Erlebnisse ausgelassen habe. (Was nicht heißt, dass die, die nicht drin steh schlecht sind! Ich war nur noch nicht da.)
Die höchste Erhebung der Stadt ist der Monte Troodelöh mit 118,04 m ü. NHN
Köln entdecken eine Übersicht
Köln
Kölner Dom
Umgebung des Kölner Doms
Altstadt
Heumarkt
Rathaus
Gürzenich
Rheinauhafen
Kirchen in Köln
Kölner Brauhäuser
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Köln
Köln
Die heutige Metropole Köln hat eine fast 2000-jährige Geschichte. Sie wurde im Jahre 50 – vermutlich unter dem Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensium (CCAA) gegründet – eine Stadt römischen Rechts und wird seit der Frankenzeit Köln genannt. Die Römer hatten zunächst eine ca. 1 km² große und befestigte Garnison auf einem Felsplateau am Rhein errichtet und ihr den Namen „Oppidum Ubiorum“ gegeben.
Hier wurde im Jahre 15 nach Christus Agrippina, die spätere Namens Geberin der Stadt, geboren.
Agrippina (die Jüngere)
Iulia Agrippina war Tochter von Agrippina, weshalb sie oft auch als „die Jüngere“ bezeichnet wird und dem römischen Feldherrn Nero Claudius Germanicus. Agrippina war auch die Schwester von Caligula, die Mutter des römischen Kaiser Nero und Frau des Kaisers Claudius.

Agrippina hat eine bewegte Familiengeschichte, die ich bei Interesse nachzulesen empfehle. Im Jahr 49 n. Chr. heiratete sie ihren Onkel Claudius und wurde dessen vierte Ehefrau. Aus erster Ehe brachte sie ihren Sohn Nero mit ein und als Claudius seiner Frau den Titel Augusta verlieh, war sie die erste römische Kaiserfrau, der dieser Titel zu Lebzeiten verliehen wurde. Dadurch erhielt Agrippina das Münzrecht. Es wird vermutet, dass aufgrund dieser Stellung aus dem Ubier-Dorf am Rhein die Colonia Claudia Ara Agrippinensium (CCAA), eine Stadt mit römischem Recht und Bürgerrechten – die höchste Auszeichnung, da sie Rom gleichgestellt wurde.
Eine Statue von Agrippina befindet sich am Rathausturm an der Nordseite.
Köln wurde noch unter Kaiser Claudius zur Hauptstadt von Niedergermanien (Germania inferior) ernannt.
Im 3. Jahrhundert wurde die erste Stadtmauer erneuert und die Stadt durch eine 100 km lange Leitung aus der Eifel mit Frischwasser versorgt. Zudem wurde die erste Brücke über den Rhein gebaut. Diese hielt bis zum Ende der römischen Besatzung ca. Ende des 4. Jahrhunderts/Anfang des 5. Jahrhunderts.
Die nächste Brücke, die in Köln über den Rhein errichtet wurde war die heute nicht mehr existierende Dombrücke um 1859. An ihrer Stelle steht seit 1911 die Hohenzollernbrücke.
Kölsch – die einzige Sprache der Welt, die man trinken kann
Der Begriff „Kölsch“ für dieses Bier tauchte erstmals 1918 auf. Die Brauerei Sünner warb in diesem Jahr erstmals mit dem Begriff „Kölsch“ für ihr helles, obergäriges Bier.
Um die Qualität und den Ursprung des Kölsch zu schützen, wurde 1985 die Kölsch-Konvention eingeführt. Diese Vereinbarung legt fest, dass Kölsch nur in bestimmten Brauereien in Köln und Umgebung gebraut werden darf und bestimmte Qualitätskriterien erfüllen muss.
Mehr dazu erfährst Du im Artikel über das Obergärige:

Seit 1997 ist „Kölsch“ eine geschützte geografische Angabe (g.g.A.) in der Europäischen Union. Das bedeutet, dass der Begriff „Kölsch“ nur für Bier verwendet werden darf, das in der Region Köln gebraut wurde.
zurück zur Kölner Übersicht
Kölner Dom
Der Kölner Dom ist mit 4,3 Millionen Besuchern pro Jahr die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Deutschlands. (Auf Platz 2 die Elbphilharmonie in Hamburg mit 2,8 Mil. Besuchern und auf Platz 5 Schloss Neuschwanstein mit rund 1,4 Mil. Besuchern)
Der Kölner Dom, mit seinen beiden Türmen, wurde in der Nachkriegszeit zu einem Symbol für den Wiederaufbau und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Seit 1996 gehört der Kölner Dom zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist ein gotisches Bauwerk mit sage und schreibe 632 Jahren Bauzeit.

Baubeginn
Am 15. August 1248, 84 Jahre nachdem die Heiligen 3 Könige nach Köln kamen, wurde mit dem Bau des Doms begonnen.
Fertigstellung
Der Dom-Innenraum wurde 1848 geweiht. Im Jahr 1880 wurden schließlich die Arbeiten am Kölner Dom abgeschlossen am 15.10.1880 wurde die Fertigstellung gefeiert.
II Weltkrieg
Der Kölner Dom sah aufgrund seiner Größe nach dem Krieg gegenüber den rundherum zerbombten Köln unversehrt und standhaft aus. Er war jedoch schwer beschädigt und erhielt im Laufe des Krieges etwa 70 Bombentreffer, von denen 14 als schwere Treffer galten.
Nach dem Krieg begann der Wiederaufbau der Stadt und des Doms. Erst in den Jahren 1995 bis 2005 wurde die „Domplombe“ im Nordturm aufwendig restauriert und mit Werkstein verblendet. Dabei wurde darauf geachtet, die ursprüngliche Bausubstanz so gut wie möglich zu erhalten.
Richter Fenster
Das Richter Fenster wurde im Jahr 2007 fertiggestellt und ist damit das jüngste Fenster im Kölner Dom. Es ersetzte ein zuvor zerstörtes Fenster aus dem Zweiten Weltkrieg. Es besteht aus 11.263 Farbquadraten in 72 verschiedenen Farben. Die Quadrate sind nach dem Zufallsprinzip angeordnet. Gerhard Richter ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Deutschlands.

Kardinal Joachim Meisner, der Erzbischof von Köln (1989-2014) zur Zeit der Entstehung des Richter-Fensters, äußerte sich kritisch über das Fenster. Er war der Meinung, dass das Fenster nicht in den Kölner Dom passe und es besser in eine Moschee oder ein anderes Gebetshaus passen würde. Er begründete seine Kritik damit, dass das Fenster nicht den christlichen Glauben widerspiegele.
Heilige Drei Könige
Vorab, laut Bibel waren es Magier aus dem Osten, weder drei noch heilig und schon gar keine Könige. Die drei beruht wohl auf den drei Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe)
Die der Sage nach sterblichen Überreste sind seit 1164 in Köln. Friedrich Barbarossa, auch bekannt als Friedrich I., unternahm mehrere Feldzüge nach Italien, um seine kaiserliche Autorität durchzusetzen und die aufstrebenden Städte Norditaliens unter seine Kontrolle zu bringen. Mailand, eine der mächtigsten und widerstandsfähigsten Städte der Lombardei, leistete dabei erbitterten Widerstand.
Nach längerer Belagerung und mehreren Schlachten gelang es Friedrich Barbarossa, Mailand im Jahr 1162 einzunehmen und zu zerstören. Die Stadt wurde geplündert und viele Einwohner wurden getötet oder vertrieben. Dies war eine drakonische Maßnahme, um die Stadt für ihren Widerstand zu bestrafen und ihre Macht zu brechen.
Der Kölner Erzbischof Rainald von Dassel spielte eine entscheidende Rolle bei der Überführung der Gebeine. Er war ein enger Vertrauter von Kaiser Friedrich Barbarossa, erhielt die Gebeine dann als Geschenk und brachte sie nach Köln.
Am 23. Juli 1164 trafen die Gebeine in Köln ein und wurden feierlich im Dom aufgestellt.
Die Überführung der Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln war somit ein Zusammenspiel aus religiösen, politischen und wirtschaftlichen Motiven. Sie trug maßgeblich zur Entwicklung Kölns zu einer bedeutenden Metropole des Mittelalters bei.
Domschatzkammer
Die Domschatzkammer befindet sich auf der Nordseite des Kölner Doms, in den historischen Kellergewölben. Sie ist für Besucher geöffnet.
Ein Besuch der Domschatzkammer ist eine einzigartige Gelegenheit, die Schätze des Kölner Doms zu entdecken und mehr über seine Geschichte und Bedeutung zu erfahren. Die Vielfalt und Qualität der ausgestellten Objekte sind beeindruckend und vermitteln einen Einblick in die Kunst- und Kulturgeschichte des Rheinlandes.
Türme
Der Südturm des Kölner Doms galt mit seinen stolzen 157,22 m Höhe lange Zeit als höchster Kirchturm der Welt. Er wurde jedoch 1890 vom Ulmer Münster übertroffen, dessen Turm 161,53 m hoch ist
Die Bauarbeiten an den Türmen zogen sich über Jahrhunderte hin. Der Südturm wurde im 15. Jahrhundert begonnen, der Nordturm etwas später. Nach einer langen Unterbrechung im Mittelalter wurden die Bauarbeiten im 19. Jahrhundert wieder aufgenommen und 1880 vollendet.
Kreuzblume
Auf den Spitzen der beiden Türme ist eine Kreuzblume. Ein Modell dieser steht vor dem Domplatz. Sie ist ca. 10 x 5 m groß und wiegt annährend 35 t.

Die Türme im Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit
Obwohl der Kölner Dom im Zweiten Weltkrieg relativ wenig zerstört wurde, erlitten auch die Türme einige Schäden durch Bombenangriffe. Nach dem Krieg waren umfangreiche Reparatur- und Restaurierungsarbeiten notwendig, um die Schäden zu beheben.
Turmbesteigung
Der Südturm des Kölner Doms kann bestiegen werden und bietet einen atemberaubenden Ausblick über die Stadt. Die Wendeltreppe im Südturm des Kölner Doms hat 533 Stufen.
Der Hochaltar
Hochaltar, ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst.
Der Chorbereich
Chorbereich mit seinen kunstvollen Intarsien und Chorgestühlen.
Die Krypta
Unter dem Dom befindet sich die Krypta, eine der ältesten Teile des Doms. Hier sind einige der bedeutendsten Erzbischöfe von Köln beigesetzt.
Hildebold (787-818): Als enger Berater Karls des Großen spielte Hildebold eine wichtige Rolle bei der Christianisierung des Rheinlandes und der Gründung des Erzbistums Köln.
Rainald von Dassel (1159-1167): Er war maßgeblich an der Überführung der Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln beteiligt, was die Stadt zu einem wichtigen Pilgerort machte.
Konrad von Hochstaden (1238-1261): In seiner Amtszeit wurde der Grundstein für den gotischen Kölner Dom gelegt.
Engelbert I. von Köln (1186-1225), auch bekannt als Engelbert von Berg, war eine bedeutende Figur des Hochmittelalters. Er war nicht nur Erzbischof von Köln, sondern auch Herzog von Westfalen. Engelbert wurde um 1185 oder 1186 auf Schloss Burg geboren. Er entstammte dem adligen Geschlecht derer von Berg. (Altenberger Dom. dort ist sein Herz bestattet). Er wurde am 7. November 1225 in der Nähe von Gevelsberg von seinem eigenen Vetter, Friedrich von Isenberg, und dessen Anhängern überfallen und ermordet. Dieser Mord war ein dramatischer Wendepunkt in der Geschichte des mittelalterlichen Köln.

Engelbert war für seine Stadtgründungen und seine Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung Kölns bekannt. Sein Tod unterbrach diese Entwicklung und führte zu einer Phase der Unsicherheit und Stagnation. Engelbert wurde als Märtyrer verehrt und später heiliggesprochen. Sein Tod hatte somit auch eine religiöse Dimension und trug zur Stärkung des religiösen Eifers in Köln bei.
Engelbert II. von Falkenburg (1261-1274): Er verlegte die erzbischöfliche Residenz von Köln nach Bonn und trug so zur Entwicklung der Stadt bei. Und ist in Bon bestattet
Josef Frings (1942-1969): Er war ein mutiger Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und setzte sich für die Rechte der Verfolgten ein.
Joachim Meisner (1989-2014): Er war eine umstrittene Figur, die für ihre konservativen Ansichten bekannt war. Seine Amtszeit war von Debatten über den Kurs der katholischen Kirche geprägt.
zurück zur Kölner Übersicht
Umgebung des Kölner Doms
Domplatte
Warum heisst dieser Platz Roncalli-Platz?
Der Roncalliplatz am Kölner Dom ist nach Papst Johannes XXIII. benannt, der mit bürgerlichem Namen Angelo Giuseppe Roncalli hieß. Er war von 1958 bis 1963 Papst der katholischen Kirche.

Warum verfolgt ein Wolf die Dom Pröbste?
Arnold Wolff war von 1972 bis 1998 Dombaumeister in Köln. Eine interessante Anekdote ist, dass er von den Steinmetzen der Kölner Dombauhütte in Gestalt eines Wolfswasserspeiers am Dom verewigt wurde. Am Zaun kann man einen Wolf sehen, wie er die Dom Pröbste verfolgt.

Man muss schon genau hinsehen, um sie zu finden.
Hauptbahnhof
Der Kölner Hauptbahnhof, ein Drehkreuz des Eisenbahnverkehrs, hat eine bewegte Geschichte:
1859: Eröffnung des ersten „Centralbahnhofs“ am heutigen Standort, der mehrere kleine Bahnhöfe vereinte.
1894: Ein prunkvoller Neubau im Stil des Historismus wurde fertiggestellt, inklusive einer imposanten Bahnsteighalle.
Kriegsjahre: Der Bahnhof erlitt im Zweiten Weltkrieg schwere Schäden, der Wiederaufbau zog sich über Jahre hin.
Modernisierung: In den letzten Jahrzehnten wurde der Bahnhof umfassend modernisiert, um den heutigen Anforderungen an einen modernen Verkehrsknotenpunkt gerecht zu werden.
Heute: Der Kölner Hauptbahnhof ist einer der meistfrequentierten Bahnhöfe Deutschlands und ein wichtiger Knotenpunkt im europäischen Eisenbahnnetz.
Hohenzollernbrücke
Die Hohenzollernbrücke, ein Wahrzeichen Kölns, überspannt den Rhein und verbindet die Stadtteile Deutz und die Altstadt. Zwischen 1907 und 1911 unter Kaiser Wilhelm II erbaut, ersetzte sie eine ältere Dombrücke und erhielt ihren Namen nach dem preußischen Königshaus der Hohenzollern.
Die Brücke, die ursprünglich sowohl Eisenbahn- als auch Straßenverkehr trug, wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Nach dem Krieg wurde sie nur für den Eisenbahnverkehr wieder aufgebaut und später um eine dritte Gleisstrecke erweitert. Heute ist sie eine der meistbefahrenen Eisenbahnbrücken Deutschlands und ein wichtiger Bestandteil des europäischen Eisenbahnnetzes.
Ein besonderes Merkmal der Hohenzollernbrücke sind die vielen Liebesschlösser, die Paare am Geländer anbringen, um ihre Zuneigung zu symbolisieren. Diese Tradition hat die Brücke zu einem beliebten Ort für Verliebte und zu einem touristischen Anziehungspunkt gemacht.
Wallraf-Richartz-Museum
Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln, eines der bedeutendsten Kunstmuseen Deutschlands, verdankt seine Gründung dem Kölner Sammler Ferdinand Franz Wallraf, der seine umfangreiche Kunstsammlung der Stadt vermachte. 1861 eröffnet, beherbergt es Meisterwerke vom Mittelalter bis zur Moderne, darunter weltberühmte Werke wie Stefan Lochners „Muttergottes in der Rosenlaube“. Das Museum überstand zwei Weltkriege, wobei das ursprüngliche Gebäude jedoch zerstört wurde. Heute befindet sich das Museum in einem modernen Bau, entworfen vom Stararchitekten Oswald Mathias Ungers. Die Sammlung wurde im Laufe der Zeit durch bedeutende Schenkungen und Ankäufe erweitert, darunter die impressionistische und neoimpressionistische Sammlung der Fondation Corboud.
Römisch-Germanisches Museum
Das Römisch-Germanische Museum in Köln, gegründet 1974, ist ein archäologisches Museum, das die Geschichte Kölns und des Rheinlandes von der Urgeschichte bis ins frühe Mittelalter dokumentiert. Es beherbergt eine breite Sammlung von Fundstücken, darunter die weltweit größte Sammlung römischer Gläser und das berühmte Dionysos-Mosaik. Das Museum befindet sich am Roncalliplatz, in der Nähe des Kölner Doms, und ist auf den Resten einer römischen Stadtvilla errichtet. Es ist eines der meistbesuchten archäologischen Museen Deutschlands und hat seit seiner Eröffnung über 20 Millionen Besucher empfangen. Derzeit wird das Museum saniert und steht Besuchern voraussichtlich bis 2027 nicht zur Verfügung.
Dionysos-Mosaik
Das Dionysos-Mosaik wurde 1941 bei Bauarbeiten für einen Luftschutzkeller, dem sogenannten „Dombunker“, entdeckt. Es wird auf das 3. Jahrhundert nach Christus datiert.
Das Mosaik ist etwa 70 Quadratmeter groß und besteht aus rund 1,5 Millionen einzelnen Mosaiksteinen. Es zeigt Darstellungen des Gottes Dionysos, des Gottes des Weines, der Fruchtbarkeit und der Ekstase, sowie sein Gefolge von Satyrn und Mänaden bei einem Fest.
Römische Hafenstraße
Die Römische Hafenstraße befindet sich am Roncalliplatz.
Sie ist die einzige begehbare „Römerstraße“ im Herzen einer deutschen Metropole. Das Kopfsteinpflaster und die gut erhaltenen Spuren vermitteln einen authentischen Eindruck vom Leben in der römischen Stadt. Die Römische Hafenstraße ist ein Teil der alten römischen Stadtmauer, die einst das römische Köln umgab. Sie führte, wie der Name schon sagt, zum alten römischen Hafen von Köln.

Die Straße wurde 1969/70 bei Bauarbeiten für die Domplatte und die darunterliegende Tiefgarage entdeckt. Die Straße befindet sich in unmittelbarer Nähe des Römisch-Germanischen Museums, wo viele weitere Fundstücke aus der römischen Vergangenheit Kölns ausgestellt sind.
Die Straße wurde bei den Bauarbeiten etwas versetzt, um Platz für die Tiefgarage zu schaffen. Sie befindet sich also nicht mehr exakt an ihrem ursprünglichen Ort. Der freigelegte Abschnitt der Straße ist etwa 65 Meter lang und 5,5 Meter breit.
Bei dieser Versetzung wurden alle Steine nummeriert. Bei der Zusammensetzung stellte man fest, dass die Nummern vom Regen abgewaschen wurden. Was dann folgte darf als Desaster bezeichnet werden. die ausführende Baufirma platzierte alle Steine nach Gutdünken. Heraus gekommen ist eine Stolperfalle, bei der sich niemand vorstellen kann, dass so etwas römische Baukunst war, auf der Legionen schnell von einem Ort zum andern ziehen konnten.
Trinkwasserbrunnen
Geht man die Straße Richtung Rhein kommt man auf den Kurt-Hackenberg-Platz. Hier befindet sich der einzige Trinkwasserbrunnen der Stadt Köln, an dem Du Dich erfrischen und Deine Vorräte auffüllen kannst.

zurück zur Kölner Übersicht
Altstadt
Schildergasse
Die Schildergasse in Köln ist eine der beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands.
Hohe Straße
Die Hohe Straße in Köln ist eine weitere Einkaufsstraße mit vielen Geschäften und Restaurants.
Fischmarkt
Der Fischmarkt ist eine malerische Gasse mit vielen Restaurants und Cafés.
Alter Markt
Der Kölner Alter Markt ist ein historischer Platz im Herzen der Kölner Altstadt. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kölner Rathaus und ist ein beliebter Ort für Einheimische und Touristen.
Der Alter Markt hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Er diente ursprünglich als Marktplatz und Versammlungsort. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Platz zu einem wichtigen Zentrum des Kölner Lebens entwickelt.
Der Alter Markt ist von historischen Gebäuden gesäumt, die einen Einblick in die Architektur vergangener Zeiten geben. Besonders hervorzuheben sind das Alte Rathaus, das im 14. Jahrhundert erbaut wurde, und das Haus zum Breiten Herd, ein prächtiges Patrizierhaus aus dem 16. Jahrhundert.
Hier findest Du ach den Jan-von-Werth Brunnen.

Heinzelmännchenbrunnen
Der Kölner Heinzelmännchenbrunnen erinnert an die der Sage nach der die kleinen Heinzelmännchen den Kölner Handwerkern bei ihrer Arbeit geholfen haben sollen, bis sie von einer neugierigen Frau vertrieben wurden.

Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten auf dem Alter Markt ist der Heinzelmännchenbrunnen. Der Brunnen erinnert an die Kölner Heinzelmännchen, die der Sage nach den Kölner Handwerkern bei ihrer Arbeit geholfen haben sollen, bis sie von einer neugierigen Frau vertrieben wurden.
Kölner Heinzelmännchen
verfasst von August Kopisch
Wie war zu Köln es doch vordem,
Mit Heinzelmännchen so bequem!
Denn, war man faul, man legte sich
Hin auf die Bank und pflegte sich
Da kamen bei Nacht,
Eh man’s gedacht,
Die Männlein und schwärmten
Und klappten und lärmten,
Und rupften und zupften,
Und hüpften und trabten
Und putzten und schabten
Und eh ein Faulpelz noch erwacht,
War all sein Tagewerk – bereits gemacht!
Hänneschen Theater
Das Kölner Hänneschen Theater, auch bekannt als Hänneschen Puppenspiele der Stadt Köln, ist eine Institution in Köln und weit darüber hinaus. Es handelt sich um ein traditionelles Stockpuppentheater, das seit über 200 Jahren besteht und ein wichtiger Teil der Kölner Kultur ist.
Das Theater wurde 1802 von Johann Christoph Winters gegründet und hat seitdem eine bewegte Geschichte hinter sich. Es ist eng mit der Kölner Fastnacht verbunden und hat im Laufe der Zeit viele Veränderungen und Weiterentwicklungen erfahren.
Die Hauptfiguren des Theaters sind Stockpuppen, die von den Puppenspielern mit viel Geschick und Humor zum Leben erweckt werden. Die bekannteste Figur ist das Hänneschen selbst, ein pfiffiger und humorvoller junger Mann. Das Hänneschen Theater spielt Stücke in kölscher Mundart, die oft aktuelle Ereignisse und lokale Besonderheiten aufgreifen. Die Stücke sind humorvoll, satirisch und bieten einen Einblick in die Kölner Seele.

Das Hänneschen Theater ist eine wichtige Tradition in Köln. Es ist ein Ort, an dem die kölsche Sprache und Kultur lebendig gehalten werden. Viele Kölner sind seit ihrer Kindheit mit dem Theater verbunden und besuchen es regelmäßig. Es hat heute seinen festen Spielort am Eisenmarkt in der Kölner Altstadt. Das Theatergebäude ist ein wichtiger Teil der Kölner Kulturlandschaft.
Kölnisch Wasser
Farina: Das Haus Farina ist das älteste Kölnisch Wasser-Unternehmen, gegründet im Jahr 1709 von Johann Maria Farina. Es ist das „Original“ Eau de Cologne.
4711: Das Haus 4711 entstand viel später. Die genaue Geschichte ist etwas unklar, aber es wird vermutet, dass das Rezept von Wilhelm Muelhens im 18. Jahrhundert erworben wurde. Die Marke 4711, benannt nach der Hausnummer des Stammhauses, wurde im 19. Jahrhundert populär.
Farina Kölnisch Wasser
Das weltberühmte Kölnisch Wasser oder Eau de Cologne ist eng mit dem Namen Johann Maria Farina verbunden.
Erfinder ist Johann Maria Farina, ein italienischer Parfümeur, kreierte 1709 in Köln ein neues Duftwasser, das er „Eau de Cologne“ nannte – zu Ehren seiner Wahlheimatstadt. Farina’s Original Eau de Cologne ist eine leichte, zitrisch-frische Komposition, die auf einer geheimen Rezeptur aus dem 18. Jahrhundert basiert. Es enthält natürliche ätherische Öle von Zitrone, Orange, Bergamotte, Mandarine, Limette und Zeder sowie Kräuter.
Farina brachte aus Italien die Kunst der reinen Alkoholdestillation aus Wein mit. Diese Technik war die Voraussetzung für die Herstellung des hochwertigen Duftwassers. Der Name „Eau de Cologne“ bedeutet wörtlich „Wasser aus Köln“. Im 18. Jahrhundert war damit immer Farinas Duft gemeint. Heute ist Eau de Cologne die Bezeichnung für eine ganze Duftklasse.
Das Haus Farina, ansässig in Köln gegenüber dem Dom, ist der Stammsitz des Duftherstellers und der Entstehungsort des ersten Eau de Cologne. Hier befindet sich auch ein kleines Duftmuseum.
Farinas Kölnisch Wasser wurde schnell in ganz Europa populär und erlangte weltweiten Ruhm. Es wurde von Königen, Kaisern und anderen prominenten Persönlichkeiten verwendet. Die Marke Farina 1709 ist eine der ältesten noch existierenden Marken der Welt und genießt Markenschutz.
Duftmuseum Farina
Das Duftmuseum Farina in Köln ist ein ganz besonderer Ort, der die Herzen von Parfumliebhabern und Geschichtsinteressierten höherschlagen lässt. Es ist nicht nur ein Museum, sondern auch der Stammsitz der ältesten Parfümfabrik der Welt, Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz.
Hier wird die über 300-jährige Geschichte des berühmten Duftwassers lebendig. Du erfährst, wie Johann Maria Farina im Jahr 1709 das Eau de Cologne kreierte und wie es sich im Laufe der Zeit zu einem weltweit begehrten Produkt entwickelte. Bei einer Führung durch das Museum kannst du die originalen Produktionsräume aus dem 18. Jahrhundert besichtigen und einen Einblick in die Herstellungsmethoden von Eau de Cologne erhalten.
In der „Kammer der Düfte“ kannst du in die Welt des Parfümeurs eintauchen und die verschiedenen Essenzen, die für die Herstellung von Parfums verwendet werden, kennenlernen.
4711 Kölnisch Wasser
4711 Kölnisch Wasser ist ein weltberühmtes Parfüm und ein Stück Kölner Kulturgeschichte.
Das genaue Rezept für das 4711 Kölnisch Wasser ist bis heute ein streng gehütetes Geheimnis. Es wird vermutet, dass es sich um ein altes Klosterrezept handelt, das im 18. Jahrhundert nach Köln kam. Die Zahl 4711 bezieht sich auf die Hausnummer des Stammhauses in der Glockengasse in Köln. Diese Nummer erhielt das Haus während der französischen Besetzung im 18. Jahrhundert.
Der Kaufmann Wilhelm Muelhens erwarb das Rezept und gründete 1792 die Firma, die das Kölnisch Wasser herstellt.
Das 4711 Kölnisch Wasser hat einen frischen, zitrusartigen Duft mit blumigen und würzigen Noten. Es enthält unter anderem Zitrone, Orange, Bergamotte, Lavendel, Rosmarin und Neroli. Es wird traditionell auf die Haut aufgetragen, kann aber auch als Erfrischungsspray oder zur Raumbeduftung verwendet werden.
4711 Kölnisch Wasser hat Kultstatus und ist aus vielen Badezimmern nicht wegzudenken. Es gilt als Klassiker der Parfümerie.
Die blaue und goldene Verpackung mit der Hausnummer 4711 ist zu einem Markenzeichen geworden. Es ranken sich zahlreiche Anekdoten um das Kölnisch Wasser. So soll es beispielsweise Napoleon Bonaparte benutzt haben.
Das Dufthaus 4711 ist der Ursprung.
Kallendresser
Der Kallendresser ist eine der bekanntesten und beliebtesten Figuren in Köln und ein fester Bestandteil der Kölner Folklore.
Der Name „Kallendresser“ kommt aus dem kölschen Dialekt und bedeutet so viel wie „jemand, der seinen Hintern entblößt“. Es gibt verschiedene Theorien darüber, was die Figur darstellen soll. Einige deuten sie als eine Art Mahnung an die Obrigkeit, es mit ihren Forderungen und Steuern nicht zu übertreiben. Andere sehen in ihr eine Darstellung des „kleinen Mannes“, der sich auf seine Weise über die „Großen“ lustig macht. Wieder andere Interpretationen sehen im Kallendresser ein Symbol für die Freiheit und Unabhängigkeit der Stadt Köln.

Der Kallendresser ist eine Skulptur, die einen Mann zeigt, der seinen Hintern entblößt. Oft ist er dabei noch mit einer Zipfelmütze bekleidet. Es gibt verschiedene Darstellungen des Kallendressers in Köln. Die bekannteste Figur befindet sich am Haus Nr. 24 am Alter Markt, einem zentralen Platz in der Altstadt. Diese Figur wurde vom Bildhauer Ewald Mataré geschaffen.
Der Kallendresser ist nicht nur eine Skulptur, sondern auch eine Figur im Kölner Karneval. Hier tritt er als frecher und humorvoller Geselle auf, der das Publikum zum Lachen bringt. Auch in anderen Festen und Bräuchen spielt der Kallendresser eine Rolle.
Die Figur des Kallendressers hat sich im Laufe der Zeit verändert. Ursprünglich war er wohl eher eine Darstellung des „kleinen Mannes“, der sich über die Obrigkeit lustig macht. Heute ist er vor allem eine Symbolfigur für den Kölner Humor und die rheinische Lebensart.
Tünnes un Schäl
Tünnes und Schäl sind zwei der beliebtesten und bekanntesten Figuren der Kölner Folklore. Sie sind ein fester Bestandteil des Kölner Karnevals und des Hänneschen-Theaters. Ihre Statuen sind beliebte Sehenswürdigkeiten in der Stadt.
Wer sind Tünnes und Schäl?
Tünnes und Schäl sind fiktive Figuren, die das „kölsche“ Wesen verkörpern sollen. Tünnes steht für den bauernschlauen, aber gutmütigen Landmenschen, während Schäl den pfiffigen, aber manchmal auch etwas großmäuligen Städter repräsentiert. Zusammen bilden sie ein komisches Duo, das sich immer wieder in skurrile Situationen bringt.
Die Statuen von Tünnes und Schäl
Es gibt mehrere Statuen von Tünnes und Schäl in Köln. Die bekanntesten sind:
Die Bronzestatuen auf dem Alter Markt: Diese Statuen wurden 1899 von Franz Anton Becker geschaffen und stehen vor dem historischen Hänneschen-Theater. Sie zeigen Tünnes und Schäl im Gespräch.

Die Tünnes und Schäl Statuen vor Groß St. Martin: Diese Statuen sind etwas neuer und zeigen Tünnes und Schäl in einer anderen Pose. Sie stehen vor der romanischen Kirche Groß St. Martin in der Altstadt.
Die Statuen im Gürzenich: Diese Statuen sind Teil einer Figurengruppe, die den Wiederaufbau des Gürzenich nach dem Zweiten Weltkrieg symbolisiert.
Warum sind Tünnes und Schäl so beliebt?
Tünnes und Schäl sind so beliebt, weil sie die Menschen zum Lachen bringen. Sie sind ein Spiegelbild der Kölner Gesellschaft und verkörpern die rheinische Lebensart. Ihre Geschichten und Witze werden von Generation zu Generation weitergegeben und sind ein wichtiger Teil der Kölner Kultur.
Tünnes und Schäl im Karneval
Im Kölner Karneval spielen Tünnes und Schäl eine wichtige Rolle. Sie treten in Büttenreden auf und sind oft auf Festwagen zu sehen. Ihre Kostüme sind farbenfroh und fantasievoll.
Tünnes und Schäl im Hänneschen-Theater
Das Hänneschen-Theater ist ein traditionelles Kölner Puppentheater, in dem Tünnes und Schäl seit über 200 Jahren eine wichtige Rolle spielen. Die Stücke sind in kölscher Mundart und handeln oft von lokalen Ereignissen und Begebenheiten.
Millowitsch Bank
Die Millowitsch-Bank in Köln ist eigentlich ein Denkmal für den berühmten Kölner Volksschauspieler und Regisseur Willy Millowitsch. Es handelt sich um eine Bronzestatue, die Millowitsch auf einer Bank sitzend darstellt.
Hier sind einige interessante Details zur Millowitsch-Bank
Standort: Die Millowitsch-Bank befindet sich auf dem Willy-Millowitsch-Platz in der Kölner Altstadt. Dieser Platz liegt zwischen der Apostelnstraße, Gertrudenstraße und Breite Straße.
Geschichte: Das Denkmal wurde bereits zu Lebzeiten von Willy Millowitsch im Jahr 1992 aufgestellt. Ursprünglich stand es auf dem Eisenmarkt vor dem Hänneschen-Theater, wurde aber 2014 auf den neu benannten Willy-Millowitsch-Platz umgesetzt.
Bedeutung: Willy Millowitsch war eine Ikone des Kölner Theaters und des Volksschauspiels. Er war bekannt für seine humorvollen und herzerwärmenden Darstellungen. Das Denkmal soll an sein Leben und Werk erinnern und ihn als einen der größten Söhne der Stadt ehren.
Beliebtheit: Die Millowitsch-Bank ist ein beliebter Ort für Fotos und Selfies. Viele Besucher setzen sich neben die Bronzestatue und lassen sich gemeinsam ablichten. Es ist ein schönes Andenken an Willy Millowitsch und ein Symbol für die Verbundenheit der Kölner mit ihrem Volksschauspieler.
Rheinfluten
In Köln gab es im Laufe der Geschichte immer wieder hohe Überflutungen durch den Rhein. Die höchste jemals gemessene Überflutung war im Februar 1784, als der Rheinpegel einen Rekordstand von 13,55 Metern erreichte. Dieses historische Hochwasser, oft als „Jahrhunderteishochwasser“ bezeichnet, wurde durch einen Eisstau bei Niehl verursacht, der das Wasser aufstaute und verheerende Folgen hatte.
Auch in den letzten Jahrzehnten gab es in Köln immer wieder Hochwasserereignisse, die zu erheblichen Schäden führten. Zu den bemerkenswertesten gehören die Überflutungen in den Jahren 1993 und 1995, als der Rheinpegel jeweils über 10,60 Meter stieg. Diese Ereignisse führten zu einem Umdenken in der Hochwasserschutzpolitik und zur Umsetzung umfangreicher Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes vor zukünftigen Überflutungen
Der Rhein
Der Rhein ist mit seinen rund 1.233 Kilometern (Länge in Deutschland: ca. 865 km) nicht nur eine der längsten Wasserstraßen Europas, Köln liegt auf 688 km (ab Bodensee).
Schmitzsäule
Die Schmitzsäule liegt in der Nähe der Kirche Groß St. Martin. Sie soll an die Legende erinnern, dass römische Legionäre und ubische Frauen die Vorfahren der Kölner, insbesondere der Familie Schmitz, waren. Der Name „Schmitz“ ist der häufigste Nachname in Köln.

Die Säule wurde aus Natursteinen der alten römischen Hafenanlage erbaut, was die römische Geschichte der Stadt widerspiegelt. Sie ist ein Symbol für die Kölner Lebensart und Identität. Auf den vier Seiten der Säule sind verschiedene Aspekte des Kölner Lebens und der Kölner Geschichte dargestellt.
Die Schmitzsäule ist ein Denkmal für alle Kölnerinnen und Kölner.
Ostermannbrunnen
Der Ostermannbrunnen ist ein Denkmal in der Kölner Altstadt, das dem berühmten Kölner Sänger und Komponisten Willi Ostermann gewidmet ist. Er wurde von dem Kölner Bildhauer Willy Klein geschaffen. Der Brunnen wurde aus einem 14 Kubikmeter großen Muschelkalkblock gefertigt. Der Grundstein wurde am 11. November 1938 gelegt, und die Einweihung fand am 16. Februar 1939, an Weiberfastnacht, statt.
Der Brunnen zeigt 15 Figuren, die Charaktere aus Ostermanns bekanntesten Liedern darstellen. Dazu gehören unter anderem „Et Billa“, „De Tant“ und „Et Stina“. Diese Figuren stellen die Evergreens von Willi Ostermann dar.
Der Ostermannbrunnen ist ein Symbol für die Kölner Lebensart und erinnert an Willi Ostermann, der mit seinen Liedern maßgeblich zur Kölner Kultur beigetragen hat. Willi Ostermann war ein sehr bekannter Heimatdichter und Sänger.
Jan von Werth-Brunnen
Der Jan von Werth-Brunnen ist ein historischer Brunnen auf dem Alter Markt in Köln. Der Brunnen erinnert an Jan von Werth, einen Kölner Reitergeneral aus dem Dreißigjährigen Krieg (1591–1652).
Bekannt ist vor allem die Legende von „Jan und Griet“: Jan, ein Knecht, verliebte sich in die Magd Griet, die ihn jedoch abwies. Er wurde ein berühmter General, und als er Jahre später in Köln als Held einzog, erkannte Griet ihn wieder.

Der Brunnen wurde 1884 vom Kölner Verschönerungsverein gestiftet und von dem Bildhauer Wilhelm Albermann entworfen. Er besteht aus einem Obelisk, der in drei Hauptteile untergliedert ist. Auf dem Brunnen befinden sich mehrere Figuren, darunter:
Die Standfigur des Jan von Werth selbst.
Figuren, die einen Kölner Bauern und eine Kölner Jungfrau darstellen.
Der Brunnen ist ein bedeutendes Wahrzeichen der Kölner Altstadt und ein beliebter Treffpunkt. Er symbolisiert die Kölner Geschichte und die lokale Legende von Jan und Griet. Zudem spielt die Geschichte von Jan und Griet eine große Rolle im Kölner Karneval.
Die Geschichte von Jan und Griet
Die Legende von Jan und Griet ist eine bekannte Kölner Volkserzählung, die auf dem Leben des Reitergenerals Jan von Werth (1591–1652) basiert:
Jan, ein Knecht, verliebte sich in die Magd Griet, die seine Liebe jedoch aufgrund seines niedrigen Standes ablehnte. Enttäuscht zog Jan in den Dreißigjährigen Krieg, wo er sich als tapferer Soldat auszeichnete.
Im Laufe der Jahre stieg er zum gefeierten General auf.
Als er nach vielen Jahren als Held nach Köln zurückkehrte, erkannte Griet ihn wieder, als er in einem Triumphzug durch das Severinstor ritt. Jan soll Griet bei dieser Gelegenheit mit den Worten „Griet, wer et hätt jedonn!“ (Griet, hättest du es doch getan!) begrüßt haben.
Die Geschichte symbolisiert Themen wie Standesunterschiede, verpasste Gelegenheiten und den Aufstieg eines einfachen Mannes zu Ruhm und Ehre. Die Legende wird jährlich zur Weiberfastnacht in Köln durch ein historisches Spiel auf dem Chlodwigplatz aufgeführt.
Die Geschichte von Jan und Griet ist ein fester Bestandteil der Kölner Folklore und des Karnevals. Die Legende zeigt, dass auch aus einfachen Verhältnissen etwas großes entstehen kann.
zurück zur Kölner Übersicht
Heumarkt
Der Heumarkt in Köln ist ein historischer Platz im Herzen der Altstadt. Er ist einer der ältesten und größten Plätze der Stadt und hat im Laufe der Jahrhunderte eine wechselvolle Geschichte erlebt.
Geschichte des Heumarkts
Mittelalter: Der Heumarkt entstand im Mittelalter als Handelsplatz, an dem vor allem Heu und Stroh gehandelt wurden. Daher auch der Name „Heumarkt“.
Römerzeit: In der Römerzeit befand sich an der Stelle des Heumarktes ein Sumpfgebiet am Rhein, das später trockengelegt wurde.
19. Jahrhundert: Im 19. Jahrhundert wurde der Heumarkt zu einem repräsentativen Platz umgestaltet und mit Bürgerhäusern bebaut.
Zweiter Weltkrieg: Im Zweiten Weltkrieg wurde der Heumarkt stark zerstört, aber nach dem Krieg wieder aufgebaut.
Der Heumarkt ist von historischen Gebäuden gesäumt, die einen Einblick in die Architektur vergangener Zeiten geben. Besonders hervorzuheben sind:
Das Alte Kaufhaus: Das Alte Kaufhaus ist ein imposantes Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das früher als Handelskontor diente. Heute befindet sich hier ein Restaurant.
Das Haus zum Breiten Herd: Das Haus zum Breiten Herd ist ein prächtiges Patrizierhaus aus dem 18. Jahrhundert. Es ist ein Beispiel für die barocke Architektur in Köln.
Ungerm Stätz treffen – Reiterdenkmal von Friedrich Wilhelm III.
Ein beleibter Treffpunkt von dem man aus in die Altstadt strömert ist das Reiterdenkmal von Friedrich Wilhelm III., in der Umgangssprache wird das auch „Ungerm Stätz treffen“ genannt.

zurück zur Kölner Übersicht
Rathaus
Die Wurzeln des Rathauses reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Der älteste erhaltene Teil, der gotische Saalbau, entstand um 1330. Hier wurde 2007 die Bundeskonferenz mit einem Empfang beim damaligen Oberbürgermeister eröffnet. Unter den Gästen war auch der damalige JCI Weltpräsident.
Über die Jahrhunderte wurde das Rathaus kontinuierlich erweitert und umgebaut. Der markante Rathausturm, ein Meisterwerk der spätgotischen Baukunst, kam zwischen 1407 und 1414 hinzu. Die prächtige Renaissance-Laube, die den Innenhof schmückt, wurde im 16. Jahrhundert errichtet.
Rathausturm
Der 61 Meter hohe Rathausturm ist ein Wahrzeichen der Stadt. Er ist mit zahlreichen Skulpturen geschmückt, die historische Persönlichkeiten und Schutzheilige darstellen.

Der Kölner Rathausturm ist mit 124 Figuren bestückt. Diese stellen bedeutende Personen der Kölner Geschichte dar, von Herrschern und Erzbischöfen über Ratsherren und Zunftmeister bis hin zu Künstlern und Heiligen. Sie sind über die verschiedenen Etagen des Turms verteilt und spiegeln die vielfältige Geschichte und Entwicklung der Stadt wider.

Einige der bedeutendsten Figuren sind:
Die Namensgeberin Agrippina

Im Erdgeschoss: Kaiser und Könige wie Karl der Große und Otto I., sowie Erzbischöfe wie Konrad von Hochstaden und Rainald von Dassel.

Manchmal muss man genauer hinsehen.
In den Obergeschossen: Repräsentanten der verschiedenen Stände und Zünfte, wie Patrizier, Ratsherren, Kaufleute und Handwerker.
Im obersten Geschoss: Die Schutzheiligen der Stadt Köln, wie Ursula, Gereon und die Heiligen Drei Könige.
Die Figuren sind ein Spiegelbild der Kölner Geschichte und sollen an die Menschen erinnern, die die Stadt geprägt haben. Sie sind ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes von Köln.
zurück zur Kölner Übersicht
Gürzenich
Der Gürzenich in Köln ist ein historisches Gebäude, das seit über 550 Jahren als Festsaal und Veranstaltungsort dient. Es ist bekannt für seine spätgotische Architektur und seine Bedeutung für die Kölner Gesellschaft. Er wurde zwischen 1441 und 1447 nach den Plänen von Nikolaus von Bueren erbaut. Der Name „Gürzenich“ leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort „gurtzen“ ab, was so viel wie „kurz“ oder „klein“ bedeutet.
Dieser Saal ist ein wichtiger Ort für gesellschaftliche Ereignisse in Köln. Hier finden regelmäßig Konzerte, Bälle, Empfänge und andere Veranstaltungen statt. Der Gürzenich ist auch ein wichtiger Ort für den Kölner Karneval. Viele Karnevalsvereine haben hier ihre traditionellen Sitzungen.
zurück zur Kölner Übersicht
Rheinauhafen
Der Rheinauhafen in Köln ist ein architektonisches Highlight und ein Ort der Vielfalt. Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Teil der Kölner Häfen angelegt und diente lange Zeit als wichtiger Umschlagplatz für Güter. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Rheinauhafen zu einem modernen Stadtteil mit Wohnungen, Büros, Dienstleistungen und Gewerbe entwickelt.
Die Mischung aus historischen Lagerhäusern und moderner Architektur, insbesondere den markanten Kranhäusern, macht den Rheinauhafen zu einem einzigartigen Ort.
Die drei Kranhäuser, entworfen vom Architekten Alfons Linster, sind das Wahrzeichen des Rheinauhafens. Ihre Form erinnert an die alten Hafenkräne und bietet einen beeindruckenden Anblick. Zahlreiche historische Gebäude, wie zum Beispiel das Zollamt und das Siebengebirgehaus, erinnern an die Vergangenheit des Hafens.

Der Rheinauhafen bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, darunter Restaurants, Cafés, Galerien und das Schokoladenmuseum.
Besondere Merkmale
Die direkte Lage am Rhein mit der Promenade lädt zum Spazieren und Verweilen ein.
Der Rheinauhafen verfügt über einen Yachthafen, der eine maritime Atmosphäre schafft.
Olympiamuseum
Das Deutsche Sport & Olympia Museum in Köln ist eine tolle Anlaufstelle für Sportfans und Geschichtsinteressierte. Hier sind einige Informationen zu dem beliebten Museum:
Was gibt es zu sehen?
Eine Zeitreise durch 3000 Jahre Sportgeschichte von der griechischen Antike bis in die Gegenwart. Höhepunkte sind u.a. ein originaler Boxring, ein Formel 1 Wagen von Michael Schumacher und eine Torwand, wie aus dem ZDF-Sportstudio.
Regelmäßig gibt es neue Ausstellungen zu verschiedenen Sportarten und Themen.
Zahlreiche Mitmachangebote, bei denen Besucher ihre sportlichen Fähigkeiten testen können.
Das Museum liegt im Kölner Rheinauhafen in einem historischen Zollgebäude. Es ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar.
Schokoladenmuseum
Das Schokoladenmuseum in Köln ist ein Muss für alle Schokoladenliebhaber und solche, die es noch werden wollen. Es ist nicht nur ein Museum, sondern eine Erlebniswelt rund um das Thema Schokolade.

Von den Anfängen bei den Olmeken und Maya bis zur modernen Schokoladenherstellung kannst du die faszinierende Geschichte der Schokolade entdecken. Erfahre alles über den Anbau von Kakao, die verschiedenen Kakaosorten und die Verarbeitung von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade.
Beobachte die Schokoladenherstellung live in der gläsernen Fabrik und sieh, wie aus Kakaobohnen leckere Schokoladenprodukte entstehen. Nasche an unserem drei Meter hohen Schokoladenbrunnen mit leckerer, flüssiger Schokolade.
Kreiere deine eigenen Pralinen und lerne von Chocolatiers die Geheimnisse der Schokoladenherstellung. Probiere verschiedene Schokoladensorten und entdecke die Vielfalt der Aromen.
Malakoffturm
Der Malakoffturm ist ein Überbleibsel der preußischen Rheinuferbefestigung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und diente einst der Sicherung des Hafens. Heute steht er markant an der Einfahrt zum Rheinauhafen und ist ein beliebtes Wahrzeichen, das Du nicht übersehen kannst. Im Turm befindet sich ein Café, und Du findest dort auch die technische Ausstattung für die historische Drehbrücke, die den Rheinauhafen mit dem Festland verbindet. Wenn Du ihn besuchst, hast Du von der Hafenterrasse aus einen schönen Blick auf den modernen Rheinauhafen und das Schokoladenmuseum, das direkt daneben liegt.

Zu Fuß des Malakoffturms gibt es den Matrosen Grill und die hafenterasse, eine Imbisshütte und einen Biergarten von dem man aus im Schatten den Rhein betrachten und bei leckeren lokalen Kaltgetränken ausspannen kann.
Senfmuseum
Das Senfmuseum in Köln ist ein ganz besonderer Ort, der die Herzen von Feinschmeckern und Genießern höherschlagen lässt. Es ist kein klassisches Museum im herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr eine historische Senfmühle, in der seit über 200 Jahren Senf auf traditionelle Art und Weise hergestellt wird.
Du kannst die historische Senfmühle aus dem Jahr 1810 bestaunen und den Senfmüllern bei der Arbeit über die Schulter schauen. Dabei erfährst du alles über die traditionelle Herstellung von Senf, von der Auswahl der Senfsaaten bis hin zur Abfüllung des fertigen Produkts.
Das Museum vermittelt auf anschauliche Weise die Geschichte des Senfs, von seinen Ursprüngen als Heilmittel bis hin zu seiner heutigen Bedeutung als Würzmittel.
Im Anschluss an die Führung hast du die Möglichkeit, verschiedene Senfsorten zu probieren und deinen Favoriten zu finden. Im Museumsshop kannst du die verschiedenen Senfsorten sowie weitere regionale Spezialitäten erwerben.
Bayenturm
Der Bayenturm ist ein mittelalterlicher Wehrturm, der im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Er war einst der südliche Eckturm der Kölner Stadtmauer und damit ein zentraler Bestandteil der Stadtbefestigung. Er spielte sogar eine wichtige Rolle im Kampf der Kölner Bürger gegen den Erzbischof, was ihn zu einem Symbol der frühen bürgerlichen Freiheiten machte. Nach seiner fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde der Bayenturm in den 1980er und 90er Jahren wieder aufgebaut. Heute beherbergt er den FrauenMediaTurm (FMT), ein feministisches Archiv und Dokumentationszentrum, das von Alice Schwarzer initiiert wurde und sich der Sicherung und Vermittlung der Geschichte der Frauenemanzipation widmet.
zurück zur Kölner Übersicht
Kirchen in Köln
Im Erzbistum Köln gibt es rund 1.200 Gotteshäuser, davon sind etwa 920 Kirchen und 300 Kapellen. Es heißt, dass es in Köln für jeden Tag eine (katholische) Kirche geben soll.
Groß St. Martin
Diese romanische Kirche mit ihrem markanten Vierungsturm ist eine der zwölf großen romanischen Kirchen Kölns.

St. Aposteln
St. Aposteln, eine weitere romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert mit einer beeindruckenden Fassade und einer reichen Innenausstattung.
St. Gereon
St. Gereon ist eine der ältesten Kirchen Kölns, die auf einem römischen Gräberfeld errichtet wurde. Sie beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Reliquien.
St. Andreas
St. Andreas ist eine romanische Kirche mit einer bedeutenden Vergangenheit. Hier befindet sich das Grab des Heiligen Albertus Magnus.
St. Kunibert
St. Kunibert: Die letzte der zwölf großen romanischen Kirchen, die direkt am Rhein liegt und für ihre Glasfenster bekannt ist.
St. Ursula
St. Ursula ist eine romanische Kirche, die für ihre beeindruckende Sammlung von Reliquien der Heiligen Ursula und ihrer Gefährtinnen bekannt ist.
Hier liegen die Heilige Ursula und die 11.000 Jungfrauen begraben bzw. ihre Gebeine schmücken einen Raum neben der Kirche. Daneben liegt die legendäre Schreckenskammer
St. Maria im Kapitol
St. Maria im Kapitol, eine romanische Kirche, die auf den Resten eines römischen Tempels errichtet wurde und eine bedeutende Sammlung von Kunstwerken beherbergt.
Hier steht auch das Dreikönigenpförtchen, op Kölsch Dreikünnijepöötzche. Im Jahr 1164 soll Erzbischof Rainald von Dassel die Gebeine der Heiligen Drei Könige aus Mailand durch eben dieses Tor nach Köln gebracht haben.
St. Maria Lyskirchen
St. Maria Lyskirchen, eine romanische Kirche mit einer ungewöhnlichen Form und einer reichen Ausstattung.
St. Georg
St. Georg, eine romanische Kirche, die für ihre schlichte Eleganz und ihre ruhige Atmosphäre bekannt ist.
St. Pantaleon
St. Pantaleon, eine romanische Kirche, die auf einem Hügel über der Stadt thront und einen weiten Blick über Köln bietet.
St. Severin
St. Severin, eine romanische Kirche mit einer bewegten Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt wurde und wiederaufgebaut wurde.
St. Kolumba
St. Kolumba, eine gotische Kirche, die im Krieg zerstört wurde und deren Ruine heute ein Mahnmal ist.
St. Cäcilien
St. Cäcilien, eine romanische Kirche, die heute das Museum Schnütgen beherbergt und eine beeindruckende Sammlung mittelalterlicher Kunst zeigt.
St. Maternus
St. Maternus, eine romanische Kirche, die für ihre idyllische Lage am Rhein bekannt ist.
Antoniterkirche
Antoniterkirche, eine barocke Kirche in der Altstadt, die für ihre prunkvolle Ausstattung und ihre Deckengemälde bekannt ist. (protestantisch)
Jesuitenkirche St. Mariä Himmelfahrt
Jesuitenkirche St. Mariä Himmelfahrt, eine barocke Kirche in der Altstadt, die für ihre elegante Architektur und ihre Stuckarbeiten bekannt ist.
Minoritenkirche St. Maria Empfängnis
Minoritenkirche St. Maria Empfängnis, eine gotische Kirche in der Altstadt, die für ihre schlichte Eleganz und ihre ruhige Atmosphäre bekannt ist.
Nicht zu vergessen
Synagoge Roonstraße, befindet sich im Stadtteil Neustadt-Süd in der Roonstraße 50, gegenüber dem Rathenauplatz. Sie ist das Zentrum der Synagogen-Gemeinde Köln.
In Köln gibt es mehrere Moscheen. Die bekannteste und größte ist die DİTİB-Zentralmoschee Köln im Stadtteil Ehrenfeld. Sie ist eine Moschee der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DİTİB).
zurück zur Kölner Übersicht
Kölner Brauhäuser
Im Sommer steht man oft draußen vor dem Brauhaus oder sitzt im Biergarten, im Winter geht’s durch „die Schwemme“ in den Schankraum und neben kleinen Happen zum Bier wird eine deftige regionale Küche angeboten.
Typische Gerichte der Kölner Brauhauskarten







Früh am Dom
Das „Früh“ ist eine Institution in Köln und eines der größten Brauhäuser der Stadt. Es liegt in unmittelbarer Nähe des Kölner Doms und bietet eine große Auswahl an Kölsch und deftigen Speisen.

Gaffel am Dom
Auch das „Gaffel“ liegt in der Nähe des Doms und ist ein beliebtes Ziel für Touristen und Einheimische. Hier wird das gleichnamige Gaffel-Kölsch ausgeschenkt.

Brauhaus Sion
Das „Sion“ ist ein traditionelles Brauhaus mit einer langen Geschichte. Es ist bekannt für sein leckeres Sion-Kölsch und seine gemütliche Atmosphäre.

Brauerei zur Malzmühle
Die „Malzmühle“ ist eine der ältesten Brauereien Kölns und bekannt für ihr Mühlen-Kölsch. Hier kannst du nicht nur das Bier probieren, sondern auch mehr über die Brauerei und ihre Geschichte erfahren.

Peters Brauhaus
Das „Peters“ ist ein weiteres traditionelles Brauhaus in der Altstadt, das für sein Peters-Kölsch und seine deftige Küche bekannt ist.

Päffgen
Bierhaus en d’r Salzgass
Brauhaus „Zum Prinzen“
Gilden im Zims „Heimat kölscher Helden“
Das Gilden im Zims
Schreckenskammer
Die Schreckenskammer liegt nicht in unmittelbarer Nähe vom Dom sondern etwas nördlich am Eigelstein. Eine sehr urige Kölschkneipe, zu der kaum ein Tourist hinfindet und wenn doch, eher umkehrt, weil er denkt, er habe sich verlaufen. Direkt an der Ursulakirche mit dem Knochenraum.


Lommy Lommertsheim
Kölner Brauwelt

Deutzer Bahnhof
Im Deutzer Bahnhof befindet sich das Deutzer Brauhaus. Lecker rustikale Küche, schönes Ambiente und auch eine nette kleine Bierterrasse.
zurück zur Kölner Übersicht
Kölner Flora
Ein Kleinod neben dem Zoo in der Kölner Nordstadt. Die Flora Köln und der Botanische Garten liegen zwischen Amtserdammer Straße und dem Stammheimer Weg, direkt hinter der Zoobrücke an der Inneren-Kanalstraße.

Die Flora Köln
Die Flora ist das zentrale, palastartige Gebäude der Anlage. Sie wurde 1864 im Stil des Historismus, genauer der Neorenaissance, errichtet. Das Gebäude diente ursprünglich als Festhaus und Palmenhaus mit einem beeindruckenden Glasdach. Ehemals befand sie sich auf dem Gelände des heutigen Kölner Hauptbahnhofs und wurde wegen seines Baus verlagert.
Heute wird die Flora hauptsächlich als gehobene Veranstaltungsstätte genutzt und ist eine beliebte Location für Konzerte, Bälle, Tagungen und Hochzeiten.
Beide Anlagen zusammen bieten eine grüne Oase im Stadtgebiet, die Erholung, Bildung und Kultur miteinander verbindet.
Der Botanische Garten
Der Botanische Garten ist eine der ältesten Gartenanlagen in Köln. Er wurde 1914 eröffnet und beherbergt auf einer Fläche von 11,5 Hektar über 12.000 Pflanzenarten aus aller Welt. Die Anlage ist in verschiedene Themengärten unterteilt, darunter:
Gewächshäuser: Ein subtropisches Haus, ein Wüstenhaus und ein Tropenhaus (aktuell teilweise im Umbau).
Gartenstile: Es gibt Bereiche im Stil eines englischen Landschaftsgartens, eines italienischen Renaissancegartens und eines französischen Barockgartens.
Pflanzenvielfalt: Der Garten zeigt eine große Vielfalt an Pflanzen, darunter eine umfangreiche Kameliensammlung und alte Bäume.
Bauerngarten und Streuobstwiese
Besonders interessant aus meiner Sicht sind der Bauerngarten, mit vielen Infos zu Kölschen Namen für regionale Kräuter und Gemüse.





Weitere Infos zur Kölschen Küche und Kölschen Tapas:
Streuobstwiese mit alten Apfelsorten.




Mehr zu den Apfelsorten erfährst Du hier:
Wichtige Informationen
Eintritt
Der Eintritt in den Botanischen Garten ist frei.
Öffnungszeiten
Der Garten ist täglich von 8:00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit (spätestens 21:00 Uhr) geöffnet. Die Gewächshäuser haben gesonderte Öffnungszeiten.
zurück zur Kölner Übersicht
Parken
Neben der Tiefgarage am Dom, gibt es zahlreiche weitere Tiefgaragen in der Umgebung die alle recht teuer sind. Oft ist es günstiger mit dem regionalen ÖPNV in die Stadt zu fahren und das Fahrzeug kostenfrei in den Außenbezirken und umliegenden Park & Ride Parkplötzen stehen zu lasen. Zudem ist es zeitlich insbesondere Abends und am Wochenende günstiger.
Am Rheinauhafen bzw. unter dem Rheinauhafen befindet sich Europas längste Tiefgarage. Sie ist stattliche 1,6 Kilometer lang und hat rund 1.400 Stellplätze.
Oberirdisch ist das Parken eher unterirdisch schlecht. Generell entwickelt sich Köln in den letzten Jahren mehr und mehr zu einer „Verkehrsberuhigten Zone“, in der PKW maximal geduldet aber keinesfalls erwünscht sind.
zurück zur Kölner Übersicht
ÖPNV
Linien 5, 14,16,18 halten direkt Am Dom, am Kölner Hauptbahnhof laufen viele Regionale und überregionale Linien zusammen, nahezu alle S-Bahnen der Region, Fernverkehr sowie Regionalbahnen und Regionalexpress
Hier gibt es einen Linienplan des Kölner ÖPNV.
zurück zur Kölner Übersicht
Hansestadt Köln
Die Deutsche Hanse entwickelte sich im 12. Jahrhundert aus den Gemeinschaften der Ost- und Nordseehändler. Allgemein wird die Gründung Lübecks, der ersten deutschen Ostseestadt, im Jahr 1143 als entscheidend für die Entwicklung der Hanse angesehen.
1160 erhielt Lübeck das Soester Stadtrecht. Dieser Zeitpunkt wird von Historikern als der Beginn der Kaufmannshanse (im Gegensatz zur späteren Städtehanse) angesehen.
Kölns Beitritt zur Hanse erfolgte nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern war ein allmählicher Prozess. Bereits im 12. Jahrhundert, also lange vor der eigentlichen Hanse, schlossen sich Kölner Kaufleute zu Gemeinschaften zusammen, um ihre Handelsinteressen zu schützen. Diese Gemeinschaften kann man als Vorläufer der Hanse betrachten.
Köln spielte in der Hanse eine bedeutende Rolle, sowohl wirtschaftlich als auch politisch.
Köln war eine der bedeutenden Hansestädte und spielte eine wichtige Rolle im hansischen Netzwerk. Die Stadt hatte enge Beziehungen zu anderen Hansestädten und profitierte vom Austausch von Waren, Wissen und Kultur.
Köln hatte aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke und seiner politischen Bedeutung ein großes Gewicht in der Hanse. Die Stadt nahm an Hansetagen teil und hatte Einfluss auf die Entscheidungen des Städtebundes.
Kölner Konföderation: 1367 wurde in Köln die Kölner Konföderation gegründet, ein Bündnis von Hansestädten für den Krieg gegen Dänemark und Norwegen. Dieses Ereignis zeigt die zentrale Rolle Kölns in der Hansepolitik.
Bereits im 12. Jahrhundert schlossen sich Kölner Kaufleute zu Gemeinschaften zusammen, um ihre Handelsinteressen zu schützen und zu fördern. Diese Gemeinschaften, auch „Hansa“ genannt, waren Vorläufer der späteren Hanse.
Bedeutender Handelsplatz: Köln entwickelte sich zu einem wichtigen Handelszentrum am Rhein und profitierte vom Handel mit England, Flandern und anderen Regionen. Die Kölner Kaufleute waren aktiv am hansischen Handel beteiligt und trugen zur wirtschaftlichen Blüte der Stadt bei.
Handelsniederlassungen: Köln hatte Handelsniederlassungen in anderen Hansestädten und wichtigen Handelszentren, wie zum Beispiel in London (Stalhof) und Brügge.
Politische Veränderungen: Politische Veränderungen und Konflikte, wie der Dreißigjährige Krieg, trugen zum Niedergang der Hanse bei. Köln verlor seine politische Unabhängigkeit als freie Reichsstadt und geriet unter preußische Herrschaft.
Gaffeln
Die „Gaffeln“ in Köln bezeichnen historische Vereinigungen von Bürgern, die eine wichtige Rolle in der politischen und sozialen Struktur der Stadt spielten. Es waren im Mittelalter 22 Gaffeln, die jeweils verschiedene Handwerkszünfte und Gilden repräsentierten.
Jede Gaffel hatte ihr eigenes Gaffelhaus, das als Versammlungsort und Repräsentationsgebäude diente. Die Gaffeln waren nicht nur für ihre Mitglieder zuständig, sondern sie hatten auch eine wichtige Funktion bei der Verwaltung der Stadt. So waren Vertreter der Gaffeln im Rat der Stadt Köln vertreten und übten somit politischen Einfluss aus.
Die 22 Kölner Gaffeln, mit ihren Zünften und den jeweiligen Gaffelhäusern, sind ein wichtiger Bestandteil der Kölner Stadtgeschichte und haben das Leben in Köln über Jahrhunderte geprägt.
Heutzutage erinnern noch einige Straßennamen und historische Gebäude an die Zeit der Gaffeln. Das Brauhaus „Zur Malzmühle“ am Heumarkt zum Beispiel, war einst das Gaffelhaus der Brauer.
zurück zur Kölner Übersicht
Essen in Köln
Im Artikel Kölsche Küch und Kölsche Tapas erfährst Du mehr rund um die kulinarischen Highlights von Köln und der regionalen Küche.
zurück zur Kölner Übersicht
Weitere Kölner Sehenswürdigkeiten
(unvollständig, da noch in Arbeit)
Eigelstein
Der Eigelstein
Hahnentor
Das Hahnentor
Melaten
Der Melaten-Friedhof
Mittelalterliche Stadtmauer
Ein gut erhaltener Teil der mittelalterlichen Stadtmauer
Römische Stadtmauer
Die Römische Stadtmauer an der Burgmauer und die Römische Stadtmauer an der Komödienstraße

Ulrepforte (Uhleporz)
Die Ulrepforte
zurück zur Kölner Übersicht
wird später bearbeitet….
Cafés
Café Reichardt
Restaurants
Hotels
Dom Hotel direkt ggü. des Doms
Excelsior Hotel Ernst direkt ggü. des Doms
etwas weiter weg
Hotel am Augustiner Platz
Marriott
Maritim
Dorint
Hyatt (schäl Sick)
zurück zur Kölner Übersicht
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Köln
Wann ist die beste Zeit, um Köln zu besuchen?
Immer. Am angenehmsten ist der Frühling (Mai bis Juni) oder der frühe Herbst (September), wenn das Wetter mild, aber nicht zu heiß ist. Auch der Sommer ist beliebt, allerdings oft mit mehr Touristen. Im Winter hat Köln (z. B. mit Weihnachtsmärkten) ebenfalls seinen Reiz.
Wie komme ich am besten in die Altstadt / zum Dom?
Der öffentliche Nahverkehr (KVB) bringt dich fast direkt zum Dom (direkt am Hauptbahnhof). Viele Straßenbahn- und Buslinien halten in der Nähe. Wenn du mit dem Auto anreist, ist das Parken in der Innenstadt teuer und knapp — es empfiehlt sich ein Park & Ride oder eine Tiefgarage etwas weiter außen zu nutzen.
Welche Sehenswürdigkeiten darf man nicht verpassen?
Zu den „Must-Sees“ zählen natürlich der Kölner Dom (mit Turmbesteigung, Domschatzkammer), die Altstadt mit ihren Kirchen, das Schokoladenmuseum und der Rheinauhafen mit den Kranhäusern. Auch das Römisch-Germanische Museum (wenn geöffnet), der Heumarkt, das Rathaus und die romanischen Kirchen sind nur ein paar der lohnenswerte Stationen direkt am Zentrum (Dom).
Ist eine Führung sinnvoll oder kann man alle Orte gut allein entdecken?
Für den ersten Eindruck ist eine geführte Tour (z. B. zu Fuß oder per Bus) sehr hilfreich, um versteckte Geschichten und Hintergründe zu erfahren. Wenn du aber gut vorbereitet bist (Stadtplan, App, Bilder, Kartenmaterial), kannst du die Altstadt und die Domumgebung auch gut selbst erkunden und dabei dein eigenes Tempo wählen.
Wie viel Zeit sollte man einplanen?
Für einen guten Überblick empfehle ich mindestens einen halben bis ganzen Tag (z. B. 4–6 Stunden), um Dom, Altstadt und Rheinauhafen anzuschauen. Wenn du Museen besuchen, eine Turmbesteigung machen oder in Cafés verweilen willst, sind auch ein ganzer Tag oder zwei durchaus sinnvoll.
Welche kulinarischen Highlights oder lokalen Spezialitäten sollte man probieren?
Typisch sind Kölsch (Bier aus Köln), Brauhausküche (z. B. „Halver Hahn“, „Happen Leberwurst“), lokale Tapas mit kölschem Einschlag, sowie regionale Gerichte in Altstadtbrauhäusern. Auch ein Besuch in einem der klassischen Brauhäuser oder eine kulinarische Stadtführung kann lohnenswert sein.
Welche Kirchen in Köln sind besonders sehenswert?
Neben dem Dom sind die zwölf romanischen Kirchen ein wichtiges Thema: z. B. Groß St. Martin, St. Aposteln, St. Gereon, St. Maria im Kapitol, St. Kunibert, St. Severin etc. Jede hat ihre eigene Geschichte und architektonische Besonderheiten.
Sind alle Museen das ganze Jahr über geöffnet?
Nicht immer — einige Museen können vorübergehend geschlossen sein (Renovierung, Sanierung) oder geänderte Öffnungszeiten haben. Es ist ratsam, vor dem Besuch die aktuellen Schließtage und Öffnungszeiten zu prüfen (z. B. auf den Websites der Museen).
Gibt es kostenlose Highlights oder lohnende Spaziergänge?
Ja — ein Spaziergang entlang des Rheins, durch die Altstadt-Gassen oder über die Hohenzollernbrücke mit Blick auf die Liebesschlösser ist kostenlos. Auch die Außenansicht des Doms, die Domplatte, die Promenade im Rheinauhafen und viele Kirchen (teilweise auch innen) sind frei zugänglich oder gegen kleine Spende.
Tipps für Familien mit Kindern?
Kinder mögen interaktive Museen (z. B. Schokoladenmuseum), entspannte Spaziergänge am Rhein, Schatzsuche in der Altstadt, kleine Zwischenstopps in Cafés oder Spielplätzen. Achte darauf, Strecken nicht zu lang zu machen und Pausen einzuplanen.
zurück zur Kölner Übersicht
Han isch jet verjesse?
Dann schreib mir und ich schau’s mir an.
🙂
Fragen und Anregungen bitte an: wirtz@lecker-wirtz.de
Gutes Gelingen beim Kochlöffel Schwingen!
#leckerwirtz #leckerwirds #meinkochplatz #sköln #kölnerdom #kölsch #kölscheküch #kölnentdecken

Köln entdecken
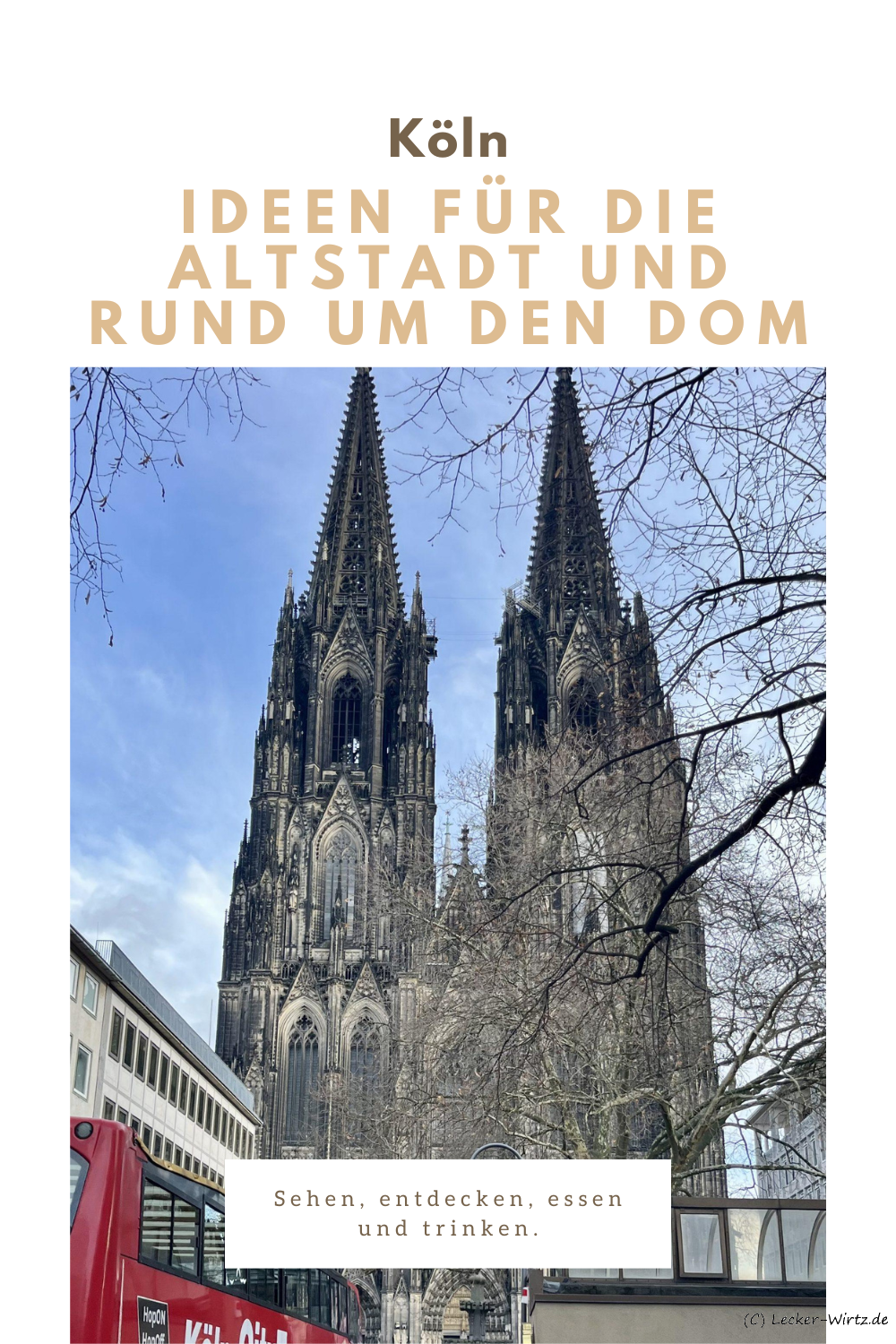
Schreibe einen Kommentar